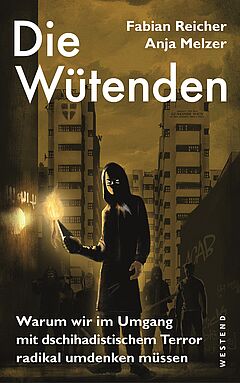Die Wütenden. Warum wir im Umgang mit dschihadistischem Terror radikal umdenken müssen
- Fachgebiete:
- Jugendarbeit
- Politische Bildung
Rezension:
“Ist der Kampf für eine gerechte Welt nicht das, worum es bei sozialer Arbeit am Ende geht, hinter all den pädagogischen Konzepten und Methoden? Was kann uns also Schöneres passieren, als Jugendliche bei ihrem Kampf um eine bessere Welt zu begleiten?” (S. 59)
In ihrem 2022 erschienenen Werk Die Wütenden. Warum wir im Umgang mit dschihadistischem Terror radikal umdenken müssen gewähren der Sozialarbeiter und ehemalige Streetworker Fabian Reicher sowie die Journalistin Anja Melzer den Leser*innen tiefgehende Einblicke in die Lebenswelten von fünf Jugendlichen in Wien. Sie schildern ihre Radikalisierung durch die Propaganda des sogenannten Islamischen Staates, ihren Ausstieg aus der dschihadistischen Szene und ihr vielfältiges Engagement, den durch die Propaganda verbreiteten Narrativen alternative Erzählungen entgegenzusetzen.
Reicher und Melzer erzählen die Lebensgeschichten von Dzamal, Outis, Adam, Sebastian und Aslan (alle Namen wurden geändert), deren Erfahrungen zwar differieren, aber auch zahlreiche Gemeinsamkeiten aufweisen: Sie alle sind wütend. Wütend darüber, dass Aufstieg und Anerkennung in einer patriarchalen und kapitalistischen Gesellschaft für sie unerreichbar erscheinen. Sie haben traumatische Kriegs- und/oder Fluchterfahrungen gemacht, ließen oft ihre Familien und Freund*innen in den Herkunftsländern zurück, um nach Österreich zu gelangen. Dort angekommen, erfahren sie Ausgrenzung und Rassismus, was beispielhaft in einer beschriebenen Polizeikontrolle deutlich wird (vgl. S. 142f).
Diese Wut richtet sich gegen ein System, das keine Chancengerechtigkeit gewährleistet. Die Vorstellung, dass individuelle Leistung zur Verwirklichung aller Ziele führt, erweist sich als leeres neoliberales Versprechen. Diese Enttäuschung bietet einen fruchtbaren Boden für die Propaganda des sogenannten Islamischen Staates, die die Idee eines Globalen Dschihad verbreitet. Reicher und Melzer sehen diese Radikalisierung als einen Prozess der gesellschaftlichen Entfremdung (vgl. S. 50).
Im Gegensatz zur gängigen, gesprächsorientierten Deradikalisierungsarbeit, die oftmals von Beratungsstellen verfolgt wird, setzt Reicher auf einen narrativ-biografischen Ansatz, der die persönlichen Lebensgeschichten der Jugendlichen mit den folgenden Dimensionen verknüpft: Erfahrung, Handlung, Werte, Emotionen, Transformation und Vertrauen.
Die Pädagogik der Wütenden, die sich an Paulo Freires Die Pädagogik der Unterdrückten anlehnt, hat ihren Ursprung nicht in universitären oder sozialwissenschaftlichen Diskursen, sondern auf der Straße – im direkten Austausch mit den Jugendlichen. Der oft von Reicher und Melzer verwendete Begriff des „intersubjektiven Raums“ verweist auf einen dialogischen Prozess des gemeinsamen Reflektierens, Begleitens und Austauschs. Diese Pädagogik erfordert es, bei den Ungerechtigkeiten, die Jugendliche erfahren, nicht wegzusehen, sondern ihnen gleichzeitig zu vermitteln, dass kein Unrecht ein anderes rechtfertigt. Die Stärkung der Autonomie junger Menschen ist ein zentrales Ziel dieses Ansatzes. Dies bedeutet einerseits, ihre Opferrolle zu erkennen und anzuerkennen, andererseits jedoch auch die progressive Seite zu fördern, die aus der Erfahrung kapitalistischer Ungerechtigkeit den Wunsch nach Veränderung schöpft (vgl. S. 215).
Reicher und Melzer entführen die Leser*innen in eine Welt, die vielen von uns – mich eingeschlossen – zunächst fremd erscheint. Die Geschichten von vermeintlich radikalisierten Jugendlichen werden meist nur in verkürzten und oftmals kriminalisierenden Narrativen der Medien präsentiert. Politiker*innen fast aller Parteien schaffen ein Klima des „Wir“ gegen „die Anderen“, indem sie Terrorismus und Islam miteinander gleichsetzen. Diese Spaltung der Gesellschaft, die Ausgrenzung von muslimisch gelesenen Jugendlichen, wird von Islamisten und Extremisten gezielt als Nährboden für ihre Rekrutierung genutzt. Reicher und Melzer brechen jedoch mit dieser vereinfachten Darstellung. Sie nehmen nicht nur das Individuum und seine Lebenswelt in den Blick (wie beispielsweise Fluchterfahrungen und Diskriminierung), sondern verstehen Radikalisierung als einen Prozess, der im Kontext von neokolonialen Strukturen, white supremacy und einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung gesehen werden muss. Sie thematisieren diese geopolitischen Aspekte anhand einiger Beispiele, wie beispielsweise der Kolonialmacht Frankreich und der Ausbeutung der Algerier*iinnen. Diese geopolitische und gesamtgesellschaftliche Perspektive ist entscheidend, um die Wirkung der Propaganda des sogenannten Islamischen Staates zu begreifen und ihr entgegenzuwirken.
Besonders bemerkenswert an diesem Werk ist, neben den bereits angesprochenen Aspekten, die Tatsache – und um hier nochmals auf das eingangs zitierte Statement zurückzukommen –, dass Reicher und Melzer den Veränderungswillen der Jugendlichen nicht zu stoppen versuchen. Vielmehr begleiten sie die Jugendlichen dabei, ihre Autonomie und Selbstwirksamkeit zu stärken und ihren Veränderungswillen in eine progressive Richtung zu lenken. In meinen Augen kann das Buch somit auch als ein Plädoyer für die Politisierung der Jugendarbeit verstanden werden. Denn es wird eindringlich deutlich, dass es nicht nur das Ziel von Jugendarbeiter*innen und Fachkräften im Umgang mit radikalisierten Jugendlichen sein kann, deren Weltbild zu verändern, sondern die Welt mitsamt ihren Ungerechtigkeiten.
Diese Jugendlichen sind wütend – zurecht - und wir sollten das auch sein.
Lorena Klotz